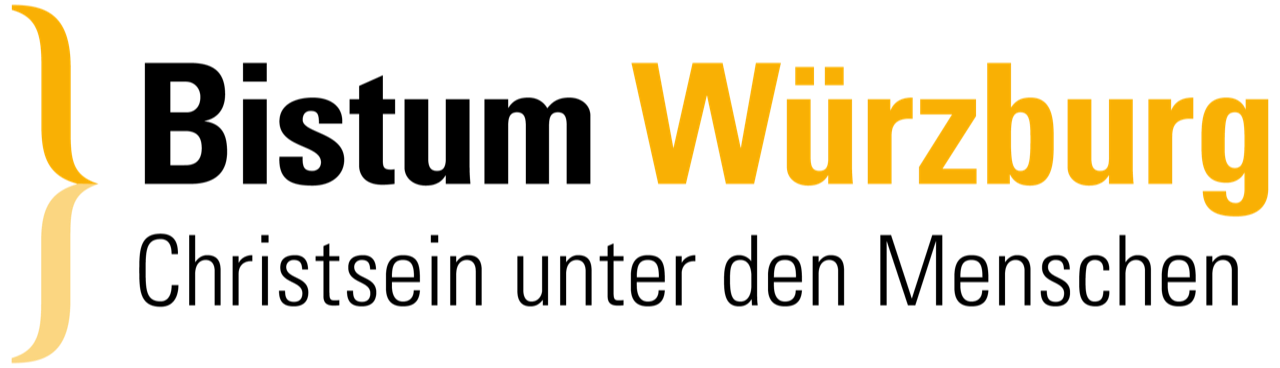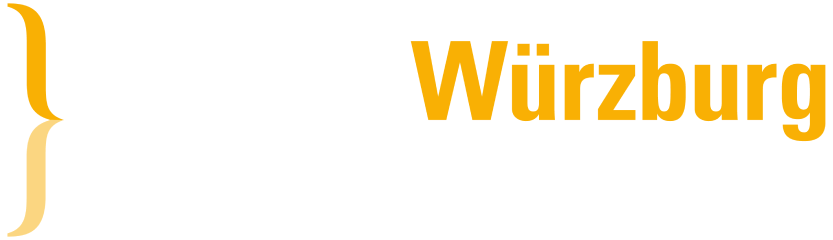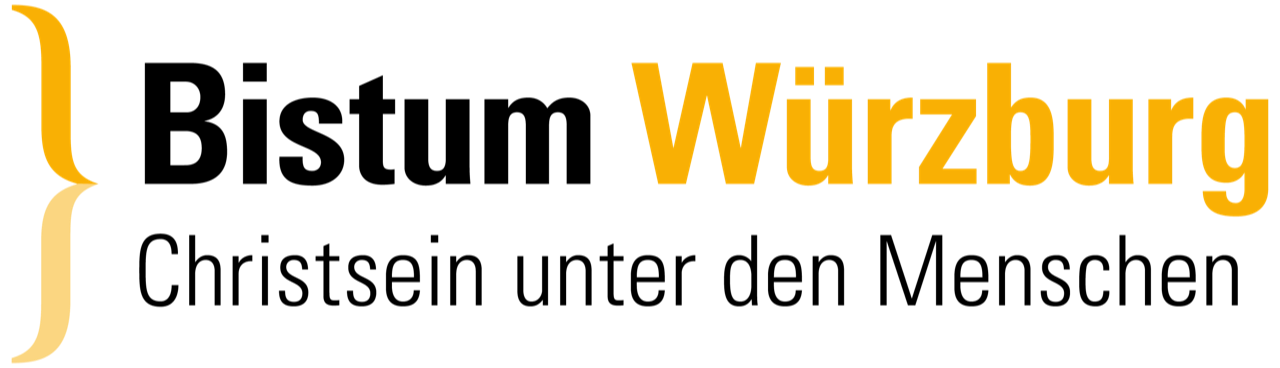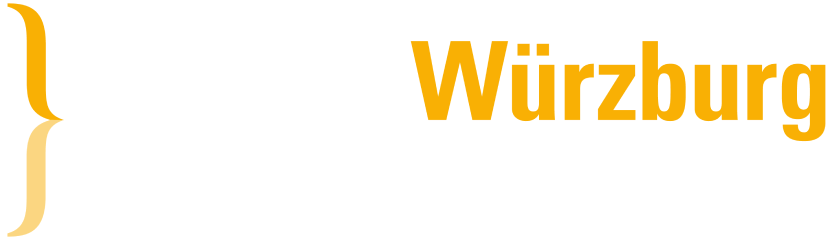Zwar lockt uns die Aussicht auf ein akzeptables Körpergewicht, eine bessere Figur und eine gesündere Lebensweise. Doch „Verzichten" hört sich erst einmal nicht so attraktiv an. Es klingt nach Askese und Strenge, Freudlosigkeit und gedämpfter Lebenslust. Als würde hinter uns ein Antreiber stehen, der sagt: „Du musst dies! Und jenes darfst du nicht!"
Verzicht ist seiner Natur nach aber immer freiwillig. Hinter ihm steckt kein Antreiber, sondern eine Möglichkeit: Ich könnte dies und jenes tun - oder lassen. Die Entscheidung liegt bei mir. Und das nicht nur in Bezug auf's Essen und Trinken. Da drängt sich jemand in der Bäckerei vor. Ich könnte protestieren und meinen Platz behaupten – und verzichte darauf. In der Steuerklärung könnte ich noch die entlegensten Winkel nach Erstattungsmöglichkeiten durchstöbern – und verzichte darauf. Ich verzichte auf ein legitimes Recht oder eine Möglichkeit – nicht weil sie grundsätzlich schlecht sind oder schädlich. Ich unterbreche einfach einen Automatismus, dem ich oft unterliege: Dass ich mitnehme, was ich kriegen kann, auch wenn ich es gar nicht brauche; dass ich auf mein Recht poche – aus Prinzip. Der Verzicht macht mich davon frei.
„Verzicht" klingt nach Verlust – und bringt mir am Ende Gewinn, nämlich Befreiung und, ja, Erlösung. Und womöglich sogar ein besseres menschliches Miteinander. Es gibt Überlegungen, ob sich eine „Ethik des Verzichts" nicht auch gesellschaftlich positiv auswirkt, wenn nicht jeder das Maximum für sich herausholt, sondern gelegentlich verzichtet zugunsten der Gemeinschaft. Und zwar nicht, weil es gesetzlich verordnet ist, sondern als freiwillige Haltung. Die wäre in jedem Fall nachhaltiger.
Die „Ethik des Verzichts" misst dem Lassen neben dem Tun einen vergleichbaren Wert zu. Beidem ist Gottes Segen verheißen – und den wünsche ich Ihnen beim „Eingang" in das noch neue Jahr 2019: „Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen, segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen" (Hartmann Schenck, EG 163).
Ihre Pfarrerin Eva Güther-Fontaine