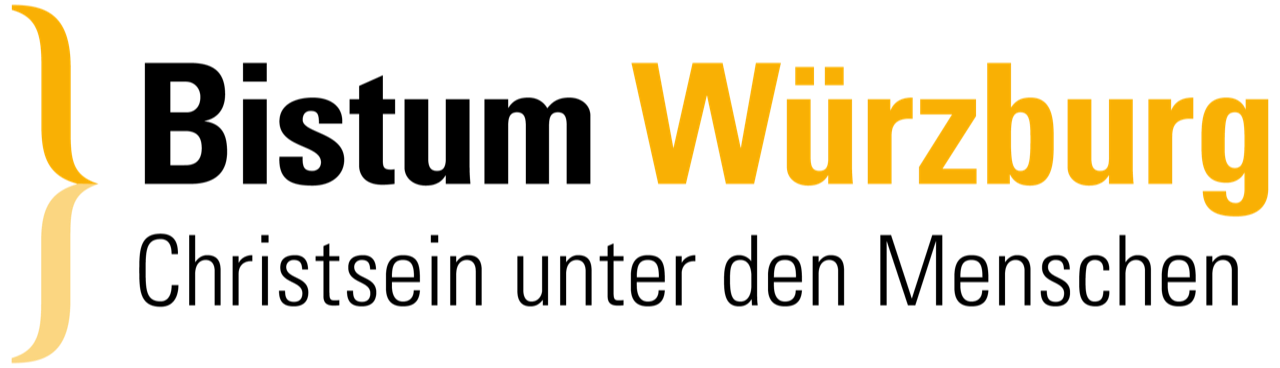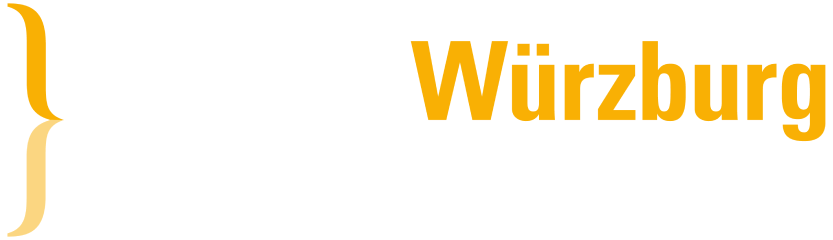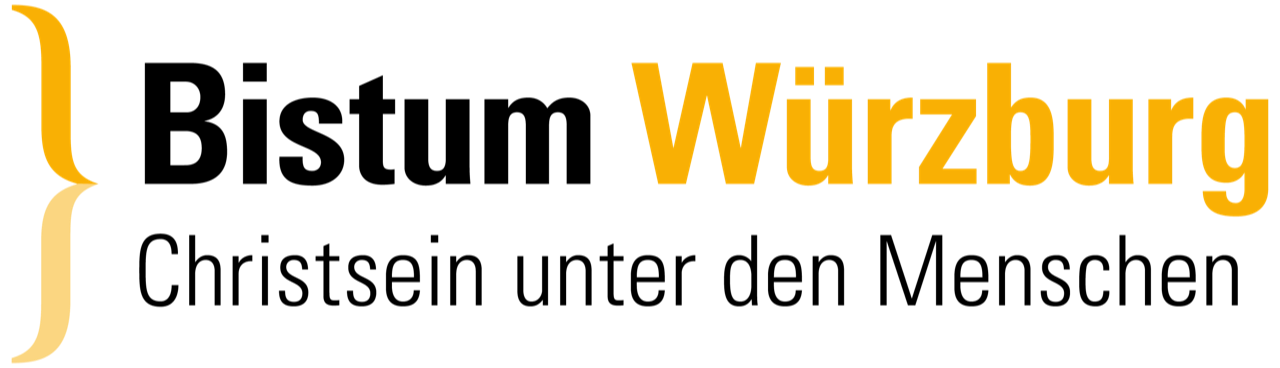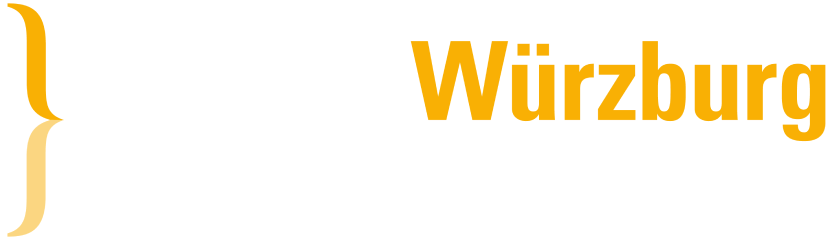ging er nicht nur auf die Entwicklungen in seiner Diözese von den DDR-Zeiten bis heute ein. Er diagnostizierte auch, dass die Entwicklungen im Osten mit denen im Westen insgesamt durchaus vergleichbar seien, auch wenn sie langsamer und mit anderen Schwerpunkten geschehen seien. „Der zunehmende Ausfall Gottes in den Alltagserfahrungen der Menschen, schwindender Widerstand des Einzelnen gegenüber gesellschaftlichen Trends und die Besetztheit durch die Arbeits- und Freizeitwelt sind Phänomene, die man durchaus auch in der Altbundesrepublik beobachten kann“, so Wanke.
Im Osten hätte man nach der friedlichen Revolution 1989 viel von den Erfahrungen der westlichen Diözesen profitieren können. Doch nachdem die Ostbischöfe zunächst Exoten in der Deutschen Bischofskonferenz gewesen seien, hätte sich jetzt das Verhältnis angeglichen: „Ich stelle eine wachsende Hörbereitschaft fest, die fragen lässt, was wir voneinander lernen können.“ Und so einige Erfahrungen der katholischen Diaspora des Ostens seien hilfreich, um die Veränderungen in der Religiosität heutiger Menschen aufzuarbeiten. Für den 1941 in Schlesien geborenen und im thüringischen Ilmenau aufgewachsenen Wanke gehört dazu zum Beispiel, dass man zu seinen auf dem Evangelium gegründeten Überzeugungen stehen sollte, auch wenn es dafür keinen Rückenwind gibt. Es war im Osten eine Alltagserfahrung der Katholiken, nicht von Mehrheitsüberzeugungen getragen zu sein sei.
Noch bei seinem Amtsantritt 1980 als Weihbischof in Thüringen, war der Gedanke einer möglichen Wiedervereinigung für Wanke reine Utopie. Der Blick der Seelsorge im Osten hätte sich ganz darauf konzentriert, wie die Diasporakirche unter den Bedingungen des sogenannten real existierenden Sozialismus ihren Grundauftrag am Besten erfüllen könne. Auf die Frage eines Zuhörers, warum die Kirche dem Staat nicht deutlicher die Stirn geboten hat, wies er darauf hin, dass die Möglichkeiten einer Minderheit angesichts des übermächtigen Staates sehr begrenzt gewesen waren. Öffentliche Verlautbarungen zu bestimmten Themen hätte es immer wieder gegeben. Doch insgesamt sei das Verhältnis von einem unausgesprochenen Gleichgewicht getragen gewesen, bei dem vor allem die praktische Arbeit in den Gemeinden im Vordergrund stand. Sicher seien wichtige Impulse für die friedliche Revolution des Herbstes 1989 von den Christen ausgegangen, aber insgesamt sei es eine bürgerschaftliche Bewegung gewesen, die den Fall der Mauer herbei geführt habe.
Mit der Wende hätten sich dann die seelsorgerischen Herausforderungen stark verändert. „Mussten wir früher gegen die Ideologie ankämpfen, der Glaube verderbe das Denken, sehen wir uns heute mit der Behauptung konfrontiert, der Glaube nehmen den Menschen die Freude am Genießen des Lebens“. Diese neuen Herausforderung geht der thüringische Oberhirte aktiv an. So führte er aus, dass es beispielsweise vor zwei Jahren anlässlich der Feiern zum 800ten Geburtstag der Heiligen Elisabeth von Thüringen gelungen sei, den Menschen zu verdeutlichen, dass die Biographie dieser bemerkenswerten Frau, die sich mit dem Himmel beschäftigt, durchaus bewirkt habe, dass wir auf der Erde etwas besser miteinander zu recht kommen. Überhaupt ließ er wiederholt durchblicken, dass für ihn vor allem die Seelsorge im Mittelpunkt steht. Immer wieder kam er darauf zu sprechen, wie wichtig es sei, das Evangelium in die Herzen der Menschen zu bringen. Strukturen stünden dabei nur an zweiter Stelle. „Jeder Leib braucht ein Skelett, aber wenn man nur noch das Skelett sieht, dann graut es einen“, sagte er zur Verdeutlichung seines Kernbotschaft, dass Kirche ein Gesicht braucht. In der Diasporasituation des Bistums Erfurt geht man dazu auch ungewöhnliche Wege. Zum Beispiel würden auch nicht getaufte junge Menschen zu Lebenswendenfeiern eingeladen. So kämen sie in dieser wichtigen Phase ihres Lebens in Kontakt mit der Kirche und viele würden sich sogar zum Abschluss der Feier segnen lassen. „Wir brauchen mehr Phantasie im vorsakramentalen Bereich“, forderte der Bischof und dachte laut darüber nach, dass die Deutsche Post ja auch keine Probleme hätte, ihre Dienstleistungen in einem Lebensmittelgeschäft anzubieten.
Es fiel angenehm auf, dass Wanke nicht einem Gejammer über den Verlust der Christlichkeit in der Welt einstimmte, sondern die Chancen hervor hob, die in den Veränderungen liegen. „Wir müssen schauen, was die neue Zeit von uns fordert“, rief er den gut 120 Besuchern seines Vortrages zu. Die Theorie vom Verschinden der Religion in der Moderne hätte sich als falsch erwiesen. Stattdessen gäbe es neue Formen einer kirchendistanzierten, ungebundenen Religiosität. ‚Wir sind auch so gute Menschen’ bekäme Wanke des öfteren von den Menschen in seinem Bistum zu hören und folgert daraus: „Auf diesen Ackerboden gibt es viele Möglichkeiten, dass aufzugreifen, was die Menschen schon an Evangelium leben. Der liebe Gott jedenfalls ist schon dort und möchte uns helfen, Brücken und Anknüpfungspunkte zu diesen Menschen zu finden!“