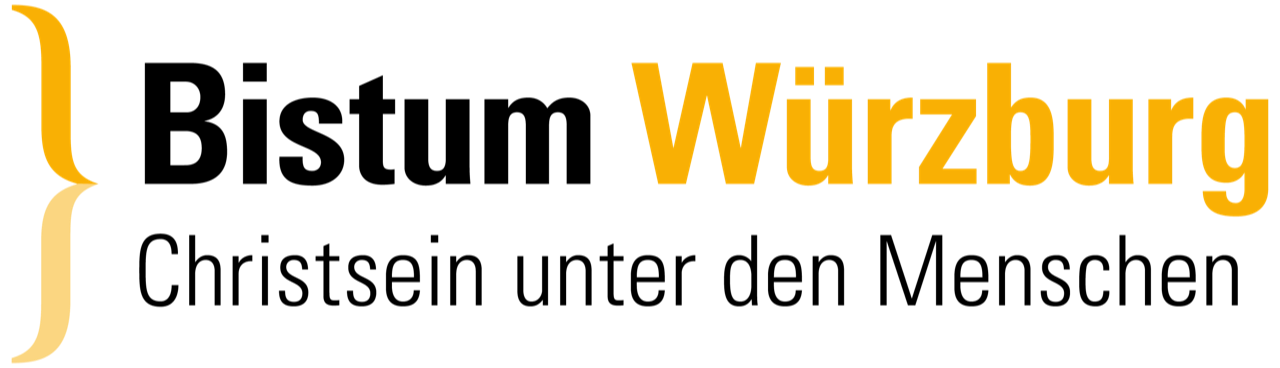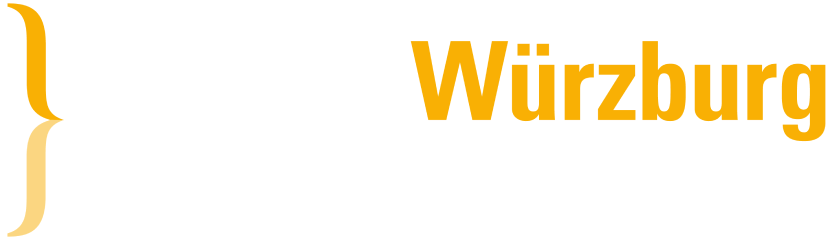Kilian war einer jener Wandermönche, die in Irland aufbrachen und „um Christi willen“ in die Fremde zogen. Zusammen mit seinen Gefährten brachte er den christlichen Glauben an den Main – und bezahlte diesen Einsatz mit dem Märtyrertod. Das geschah um das Jahr 689.
Im Jahr 1989jährte sich dieses Ereignis zum 1300. Mal und wurde vom Bistum Würzburg feierlich und zugleich besinnlich begangen. Ich selbst war damals als Jugendlicher an einem Kiliansspiel beteiligt. Besonders forderte uns die Inszenierung dieser radikalen Nachfolge: Was bewegte Kilian - und die vielen andereniro-schottische Wandermönche - ihre Heimat, ihre Familie, ihren Clan und ihr Kloster zu verlassen und sich einer ungewissen Zukunft in der Fremde anzuvertrauen -auch das bedeutete„Peregrinatio pro Christo“.
Dieses mönchische Ideal knüpfte an die ägyptischen Wüstenväter an – und letztlich an Abraham, der im Vertrauen auf Gott sein Land verließ.
Unsere Jugendgruppe beschäftigte sich damals intensiv mit diesem radikalen Bruch Kilians mit allem Vertrauten. In unserem Theaterstück ließen wir seine inneren Stimmen als Personen auftreten – die ihn einmal vorantrieben, dann wieder zurückhielten. Dieser innere Widerstreit gehört zu jedem großen Aufbruch – doch am Ende gewann der „Zug nach vorne ins Ungewisse“.
Was gab diesen jungen Männern damals den Mut und die Kraft dazu?
Ein Hinweis könnte das sogenannte Muiredach-Kreuz geben – ein knapp sechs Meter hohes Hochkreuz im irischen Kloster Monasterboice aus dem 10. Jahrhundert. Unter dem Kreuzesbalken, erst auf den zweiten Blick erkennbar, wächst aus dem Stein eine segnende Hand nach unten. Wer sich unter diese Hand stellt, schaut nach Norden – dorthin, wo die Sonne nicht scheint, dorthin, woher zur damaligen Zeit Gefahr drohte. Die Botschaft: „Wo du auch hingehst, welchen Gefahren und Herausforderungen du auch begegnest – Gott hält seine Hand über dich.“
So ist Kilian für mich nicht nur der Patron des Aufbruchs, sondern auch der des Gottvertrauens. Und wer Irland auch nur ein wenig kennt, ahnt: Diese Art von Askese war nicht mürrisch-säuerlich, sondern von einer tiefen, oft sogar fröhlich-singenden Spiritualität geprägt.
Andreas Bergmann, Pastoral- und Bildungsreferent, Kirchlicher Organisationsberater